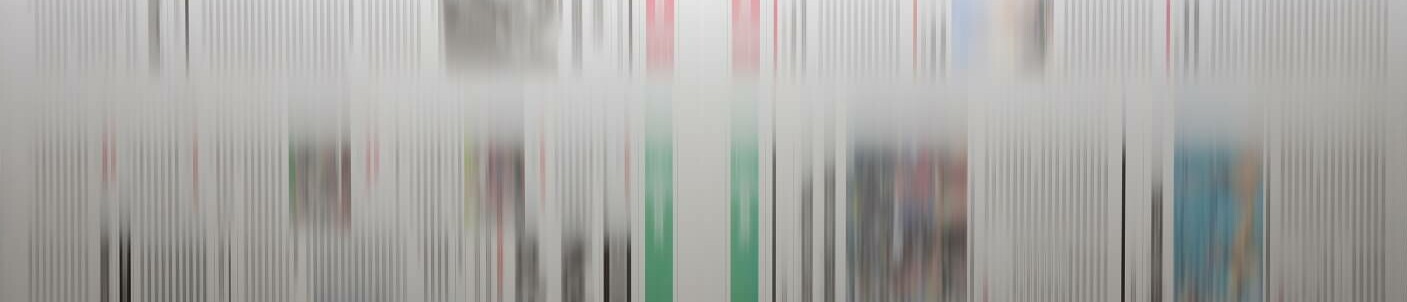
Weißbuch Wasserstoffspeicher veröffentlicht
Als Reaktion auf die Forderungen der Branche hat der Bund ein Weißbuch Wasserstoffspeicher veröffentlicht. Das Papier konkretisiert Bedarfe und Potenziale für Wasserstoffspeicher in Deutschland. Dabei werden auch regionale Unterschiede thematisiert. Das Weißbuch kann online heruntergeladen werden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat ein Weißbuch Wasserstoffspeicher veröffentlicht. Damit werden die im Rahmen der Konsultation des Grünbuchs Wasserstoffspeicher aufgeworfenen Themenfelder Speicherbedarfe und -potenziale in Deutschland konkretisiert. Das Weißbuch geht auf die Forderungen der Branche nach einer Beschleunigung von Planungs und Genehmigungsverfahren und einem langfristig planbaren Marktdesign ein. Außerdem setzt es sich mit benötigten Förderungen zur Überwindung der mit der Unsicherheit verbundenen Investitionsrisiken im Markthochlauf auseinander. Das Weißbuch sowie die Rückmeldungen der Branche hierzu können so die Grundlage für die Arbeit der Bundesregierung in der 21. Legislaturperiode in diesem Bereich bilden.
Steigender Bedarf an Wasserstoffspeichern
Bei der Energiewende und der Transformation des deutschen Energiesystems erfüllen Wasserstoffspeicher eine zentrale Funktion. Sie ermöglichen die Integration erneuerbarer Energien, können die Versorgungssicherheit erhöhen und zur Dekarbonisierung verschiedener Sektoren beitragen. Dies spielt insbesondere vor dem Hintergrund volatiler Energieerzeugung aus Wind- und Solarkraft eine entscheidende Rolle, da Energiespeicher die Flexibilität der Energieversorgung erhöhen können. In verschiedenen Szenarien (zum Beispiel den BMWK-Langfristszenarien, EWI-Modellen und der INES-Marktabfrage) wurde ein stark steigender Bedarf an Wasserstoffspeichern in Deutschland festgestellt. Bis 2030 wird ein Speicherbedarf von 2 bis zu 7 Terrawattstunden (TWh) erwartet, der bis zum Jahr 2045 auf 76 bis 80 TWh ansteigen könnte. Der Haupttreiber für diesen Anstieg ist der Einsatz von Wasserstoff in der Industrie sowie in Kraftwerken zur Rückverstromung. Die geologischen Voraussetzungen Deutschlands sind dabei optimal, um den eigenen Speicherbedarf sowie den der europäischen Nachbarn zu decken.
Verschiedene Speicheroptionen möglich
Salzkavernen böten das größte Potenzial und könnten durch obertägige Speicher wie Druck- und Flüssigwasserstoffspeicher für kurzzeitige Speicherung und dezentrale Anwendungen ergänzt werden. Zusätzlich ergeben sich in der Umwidmung bestehender Erdgas- und Erdölspeicher Potenziale für die Nutzung von Wasserstoff. Die Umwandlung bestehender untertägiger Erdgas- und Erdölspeicher zu Wasserstoffspeichern könnte 20 bis 50 Prozent des deutschen Speicherbedarfs bis 2040 decken.
Für Standort Süddeutschland H2-Infrastruktur entscheidend
Das Weißbuch attestiert Süddeutschland große Porenspeicherpotenziale, die in Bezug auf eine künftige Wasserstoffnutzung allerdings weiter erforscht werden müssen. Daher ist der Standort zunächst durch eine starke Abhängigkeit von Transportinfrastrukturen und Wasserstofflieferungen aus dem Norden und dem europäischen Ausland charakterisiert. Im Weißbuch wird gefolgert, dass der Aufbau eines umfassenden Wasserstoff-Pipeline-Transportnetzes für die süddeutschen Bundesländer von zentraler Bedeutung ist, um den Wasserstoffbedarf der regionalen Industrie zu decken und eine stabile Versorgung sicherzustellen. Im Speicherbereich sei der Bedarf insbesondere für kurzfristige Speicherlösungen, wie zum Beispiel Druckspeicher, vorhanden.
Quelle: BMWK
